ODEM thematisiert in abstrakter Darstellung den Einfluss des Menschen auf sich selbst und seine direkte Umwelt. Das Experiment wirft den grundsätzlichen Zwiespalt der sowohl zerstörerischen als auch mildernden/regenerierenden Handlungsmacht des Menschen auf verschiedenste natürliche Systeme auf.
RESPIRATION UND IMITATION
Ein und aus, ein und aus, ein und aus. Im gleichmäßigen Rhythmus vergrößert und verkleinert sich der
blaue Kreis ähnlich einer sich hebenden und senkenden menschlichen Lunge.
Die Imitation der fragilen und sensiblen, aber lebensnotwendigen Atmung, die durch diverse äußere
Ereignisse gestört und verändert werden kann, bildet das metaphorische Grundmotiv.
Behält der Nutzer den sich rhythmisch pulsierenden Kreis in der Balance, so kann er nach einiger
Zeit eine Veränderung im Hintergrund feststellen. Diese Veränderung erscheint nur, wenn das
Gleichgewicht gehalten wird, also jeweils der Bereich “empty” und “fill” gleichermaßen
berücksichtigt und angewählt werden. Wird der pulsierende Kreis kontinuierlich gefüllt, so wird er
dementsprechend größer und platzt folglich. Wird der Kreis dagegen unaufhörlich entleert,
verschwindet er und löst sich auf. Beide Szenarien sind irreversibel. Das Experiment wird gestoppt.
Der Bildschirm zeigt nun einen rückwärtslaufenden Timer an. Nach abgelaufenen 24 Stunden kann das
Experiment wiederholt werden.
ODEM konfrontiert die Rezipiente*innen mit der Intention/Absicht eine Entscheidung (mit der
Entscheidungsfindung/Auswahl) zu treffen, zwingt ihn oder sie aber nicht aktiv zur Handlung. Die
Rezipient*innen können aktiv zu Nutzer*innen werden oder gar ganz auf eine Interaktion mit dem
Experiment verzichten und Beobachter bleiben. Der Prozess wird durch eine unterlassene Handlung
nicht aufgehalten, er läuft kontinuierlich weiter. Nichtsdestotrotz bestimmt ein kontrollierter
Eingriff das Resultat.
78% N2 21% O2 0,04% CO2 0,96%
Das Projekt ruht auf der Prämisse, dass Natur, Maschinen und Subjektivitäten (in dem
Fall der Mensch
als Teil eines Systems/einer Umwelt) koexistieren und interagieren.
Zu Beginn des Projekts standen jeweils das Motiv/der Grundgedanke der Differenzierung
bzw. Der
Entscheidung/der Auswahl an Möglichkeiten und das Motiv der Imitation. Das erste Konzept
spielt mit
dem Gedanken, dass sich der Besucher, der einer physischen Installation gegenübersteht,
zwischen dem
Bestehen bzw. Überleben eines natürlichen und künstlichen/maschinellen Objekt
entscheiden muss. Hier
kann er sich zusätzlich die Frage stellen, ob eine Aktion grundsätzlich erforderlich ist
oder es
möglicherweise sogar besser wäre, sich zu enthalten, dementsprechend also nicht zu
handeln.
Mit der ersten Idee, die bereits Aspekte der Imitation von Menschen und Maschinen sowie
die
Differenzierung zweier Seiten berücksichtigt, wird eine Situation kreiert, die den
Rezipienten in
eine Ausgangslage zwingt/bewegt, sich ethischen und moralischen Fragen zu stellen. Oder
einfach
gesagt, der Rezipient wird zur Handlung, das schließt die Nicht-Handlung mit ein,
gezwungen.
Das Experiment, darin eingeschlossen der Ablauf und das resultierende Ergebnis,
konfrontiert den
Rezipienten schließlich mit seinen eigenen Gedanken und Vorstellungen. Kann das
Experiment den
Rezipienten beeinflussen (inhaltlich und visuell)? Ist er bereit das Experiment zu
wiederhohlen
(nach Ablauf des Counters/nachdem er/sie es nicht geschafft hat die Atmung im
Gleichgewicht zu
halten)?
Ändert sich die Impression/der Ersteindruck oder die Interpretation nach Beendigung des
Experiments?
Die visuelle Gestaltung des Experiments ist bewusst abstrakt gehalten, damit möglichst
viel
Interpretationsspielraum gewährleistet ist.
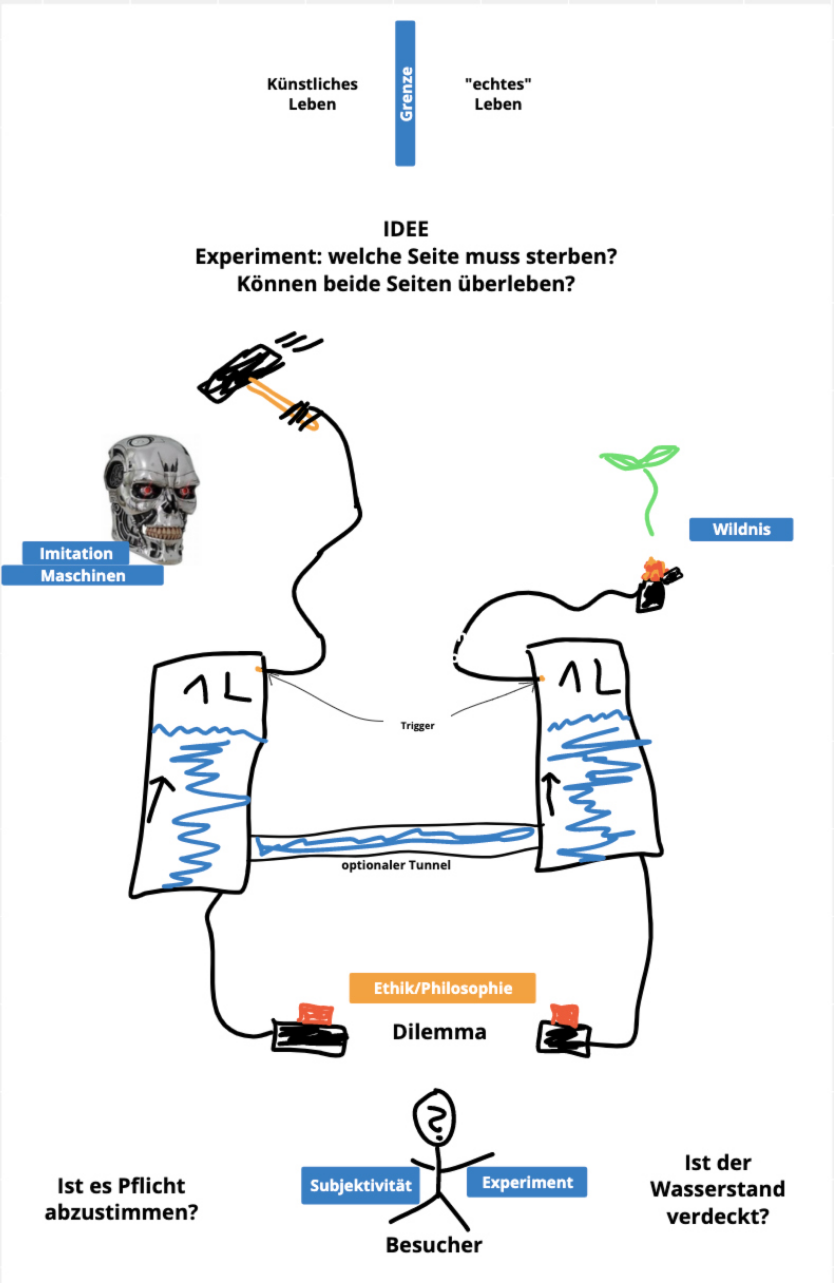
Idee 1 Qual der Wahl
Der Erstentwurf dient als philosophische Grundlage des Projekts. Ein Rezipient
der Installation sieht einen simplen Aufbau vor sich, in dem auf der einen Seite
künstliches bzw. maschinelles Leben bedroht wird, auf der gegenüberliegenden
Seite “echtes” bzw. biologisches Leben.
Der Rezipient kann sich dazu entscheiden von seiner passiven in eine aktive
Rolle zu wechseln.
Dadurch kann er eine der beiden Seiten bevorzugen, während er die andere Seite
dem Tode ein Stück näherbringt. Das Benutzer-Interface der Installation sind 2
Knöpfe. Wird einer der beiden Knöpfe zu häufig gedrückt, stirbt die
entsprechende Seite und das Experiment endet.
Das Thema der Installation ist das Problem “Ab wann ist Leben Leben und wo ist
die Grenze?”. Sie spielt mit den Fragen “ist biologisches Leben echteres Leben
und damit schützenswerter?”
Unter Umständen kommt der Rezipient auch zu der Entscheidung, dass es falsch
sei, mit einem Knopfdruck über Leben und Tod zu entscheiden und enthält sich.
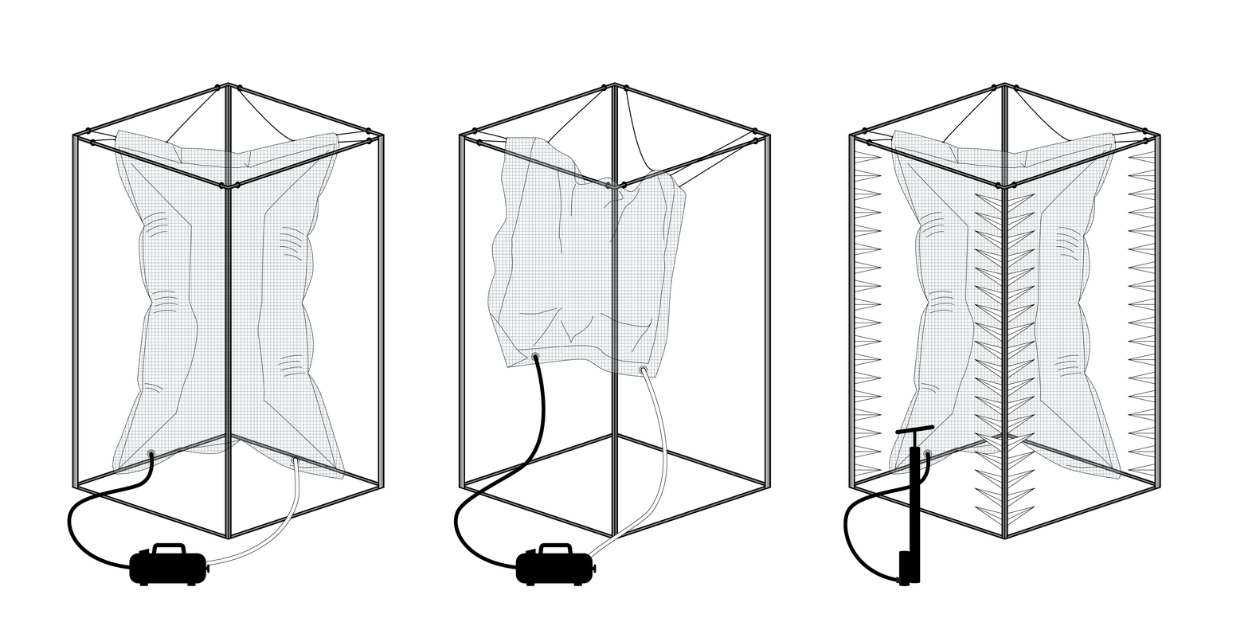
Idee 2 Luftsack-Atmung / Imitation
Das Individuum/Subjekt steht vor einer Entscheidung. Der Rezipient steht der
Installation oder
der interaktiven Anwendung gegenüber.
Der im Rahmen gehängte Plastiksack bewegt sich auf und ab. Er füllt sich mit
Luft und erweitert
sein Volumen um ein Vielfaches.
Wenige Momente später entleert sich der Sack und schrumpft merklich zusammen.
Rhythmisch pumpt
ein Kompressor Luft in den Plastiksack.
Wiederholt füllt er sich mit Luft und entleert sich daraufhin. Der Ablauf ist
iterativ. Luft
strömt in den transparenten Plastiksack und fließt langsam wieder heraus.
Die Installation imitiert die menschliche Atmung. Solange keine äußere Kraft
diesen Prozess
stört, bleibt der Atmungs-Rhythmus beständig, konstant und unverändert.
Durch eine zusätzliche Pumpe/durch eine Interaktion per Tastendruck/Button,
Bewegung der Maus
etc. erhält der Rezipient nun Nutzer und Anwender die Möglichkeit,
in den Prozess einzugreifen. Allein die Neugier, der Reiz der Nutzung treibt den
Rezipienten zur
Interaktion. Im steht offen,
ob er sich an der Installation/Anwendung beteiligt oder nur Beobachter bleibt.
Erst der Eingriff des Rezipienten verändert den Rhythmus. Die Atmung wird flach,
die Atmung wird
schneller,
die Atmung wird träger. Der Luftsack wird zu groß und gerät in Gefahr zu platzen
oder verliert
so viel Luft,
sodass er vollkommen leer ist und infolgedessen zusammensackt.
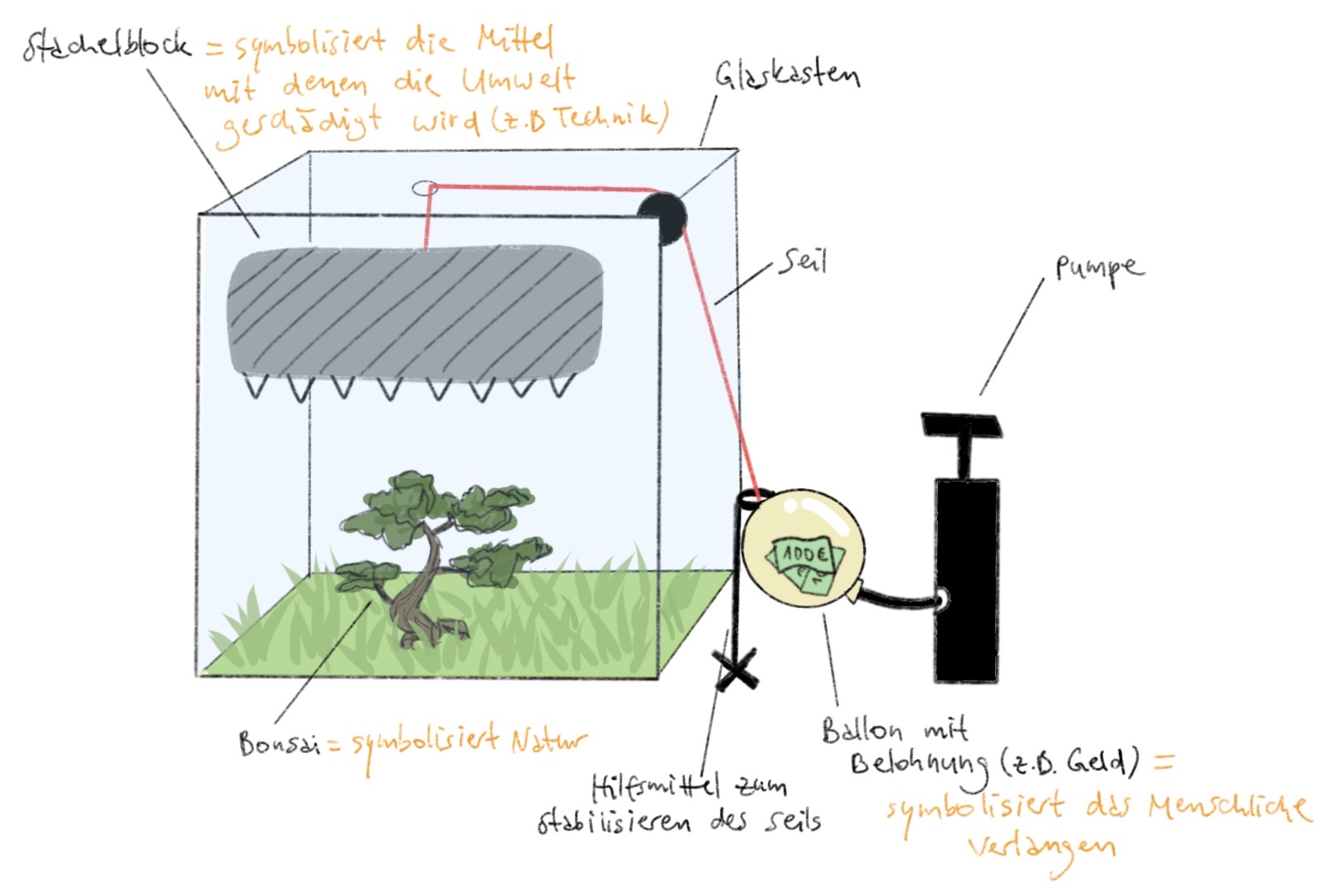
Idee 3 Gedankenexperiment
Die Skizze zeigt einen Konstruktionsvorschlag, welcher sich an der genannten Grundidee orientiert. Die zwei Gegensätze bilden die Natur und die Technik, diese wurden im dargestellten Versuch durch einfache Gegenstände ersetzt. In dem Glaskasten, befindet sich eine Pflanze welche die Natur symbolisiert. Es wurde ein kleiner Bonsaibaum verwendet, da diese Art für ihre Langlebigkeit bekannt ist und für den Menschen von großem Wert ist. Außerhalb des Kastens ist eine Pumpe angebracht an welcher sich ein Ballon, gefüllt mit Geldscheinen befindet. Mithilfe der Pumpe kann der Ballon aufgepumpt werden, das Geld symbolisiert hierbei das menschliche Verlangen. Über der Bonsaipflanze hängt ein großer Stachelblock an einem dünnen Seil, welcher mit dem Ballon verbunden ist. Durch seine Größe und die bedrohlich wirkenden Stacheln wird er zum Symbol für die Mittel, welche der Mensch gegen die Natur einsetzt. Damit das Seil den Stachelblock halten kann wird ein Stabilisator am Boden angebracht. Dieser ist oben ringförmig, der Ballon passt jedoch nicht durch und erzeugt somit eine Spannung im Seil. Würde sich also der Betrachter dafür entscheiden an das Geld im Ballon zu kommen, müsste er die Pumpe betätigen um den Ballon zum Platzen zu bringen. Durch das Platzen jedoch, passt das befestige Seil nun durch das Loch am Stabilisator. Somit löst sich die Spannung des Seils und der Stachelblock zerdrückt den Bonsai. Der Betrachter müsste also sein Verlangen beiseite schieben, um den Baum am Leben zu halten. Dieses Experiment kann in der Praxis nur so lange durchgeführt werden, bis sich eine Testperson dazu entscheidet den Ballon platzen zu lassen. Es scheint also sinnvoller zu sein, dies als ein Gedankenexperiment zu sehen.
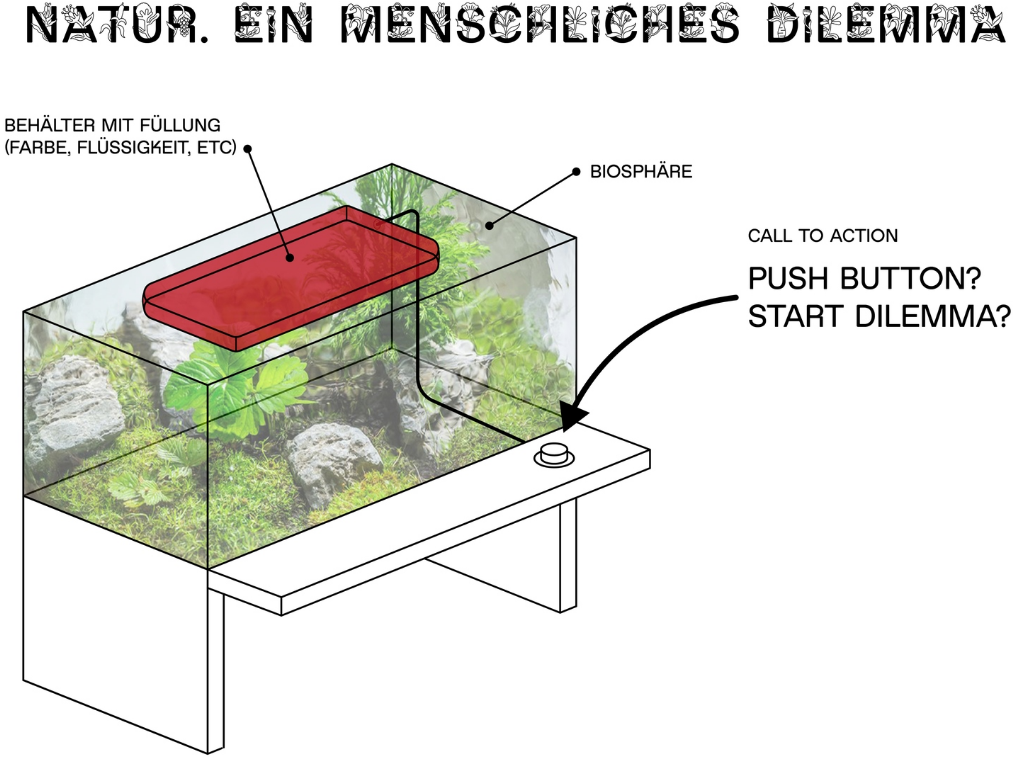
Idee 4 Biosphäre / Wachstum / Zerstörung
In einer Biosphäre sind Pflanzen platziert, die mit der Zeit wachsen und gedeihen können. Die Biosphäre ist von allen Seiten einsehbar. Lediglich an der Decke hängt ein Gefäß, ein Beutel gefüllt mit einer Flüssigkeit. Außen an der Biosphäre ist ein Knopf angebracht, mit dem der Rezipient das Gefäß bzw. Den Beutel platzen lassen kann. Durch Betätigung des Knopfes würde sich die Flüssigkeit (Farbe oder Säure) auf die Pflanzen verteilen und diese dadurch zerstören. Es liegt nun ganz am Rezipienten. Ist der Reiz so groß, den Knopf zu drücken oder unterlässt er/sie seine Handlung.
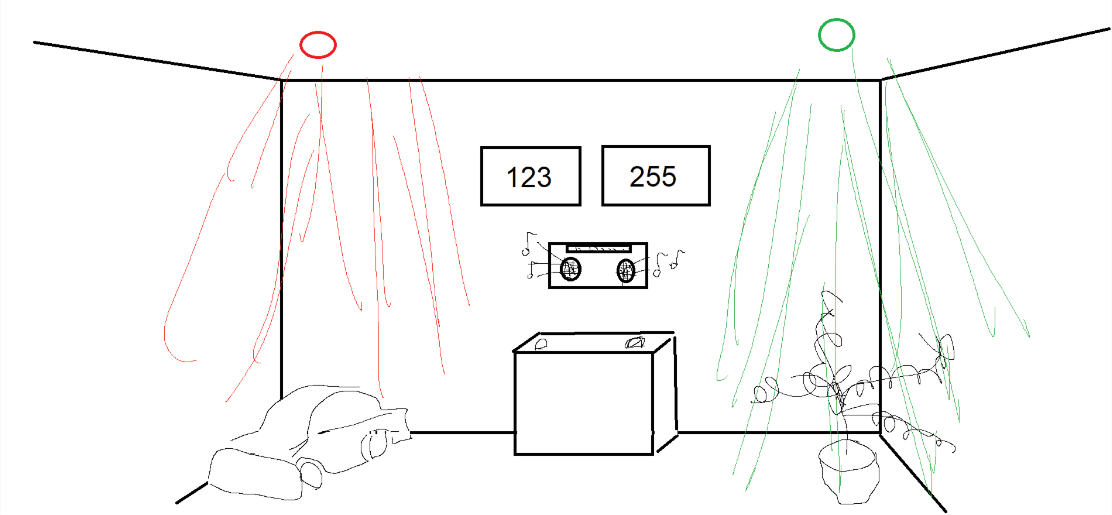
Idee 5 Squid Game
Die Installation befindet sich in einem dafür ausgelegten Raum. Dabei ist
dieser
in zwei Hälften
aufgeteilt, die Linke repräsentiert die Maschinen, dargestellt durch ein
Auto.
Die Rechte Seite steht für die Natur, dargestellt durch eine oder mehrere
Pflanzen.
Wenn ein Mensch diesen Raum betritt sieht er direkt am Ende des Raumes genau
in
der Mitte eine
Vorrichtung. Diese Vorrichtung besteht aus einem Tisch mit 2 Knöpfen, und
einem
Display,
an welchem der aktuelle Stand angezeigt wird. Nun hat er die Wahl für welche
Seite er abstimmt.
Je nach aktuellem Stand wird im Raum entweder die Linke oder die Rechte
Seite
atmosphärisch
beleuchtet.
Dazu verändert sich diue Lautstärke von Straßenlärm zu Dschungelgeräuschen,
ja
nach aktuellem
Stand.
Der ganze Versuch ist stark an die Abstimmung aus der Serie
Squid
Game
angelehnt, bei der die
Menschen abstimmen müssen,
ob die Spiele bei denen 255 von 256 Teilnehmern sterben werden, angehalten
werden sollen, oder
nicht. In diesem Fall erhält der einzige überlebende viel Geld.
Idee 6
Die Ideenfindung im Team hat einige gemeinsame Motive herausgestellt. Der Aspekt der Imitation sowie die Entscheidungsfindung des Nutzers findet sich in allen Überlegungen wieder. Die Umsetzung des Konzepts sollte zunächst in Form einer interaktiven Installation realisiert werden. Dazu eigneten sich sowohl die Idee des mit Luft gefüllten Behältnisses als auch das Modell der Biosphäre. Um den Rezipienten aber genügend Interpretationsspielraum zu überlassen und das Experiment auch weitestgehend interaktiv und nachhaltig im Sinne der Wiederhohlbarkeit zu gestalten, haben wir uns entschieden eine abstrakte Web-basierte Anwendung zu entwickeln. Das interaktive Web-Experiment/Anwendung ist zudem für eine Vielzahl an Anwendern nutzbar. Diese digitale Version hat den Vorteil, dass der irreversible/zerstörerische Charakter des analogen Experiments nur bedingt zum Vorschein kommt. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit, ist es dem Nutzer gestattet das Experiment zu wiederhohlen.
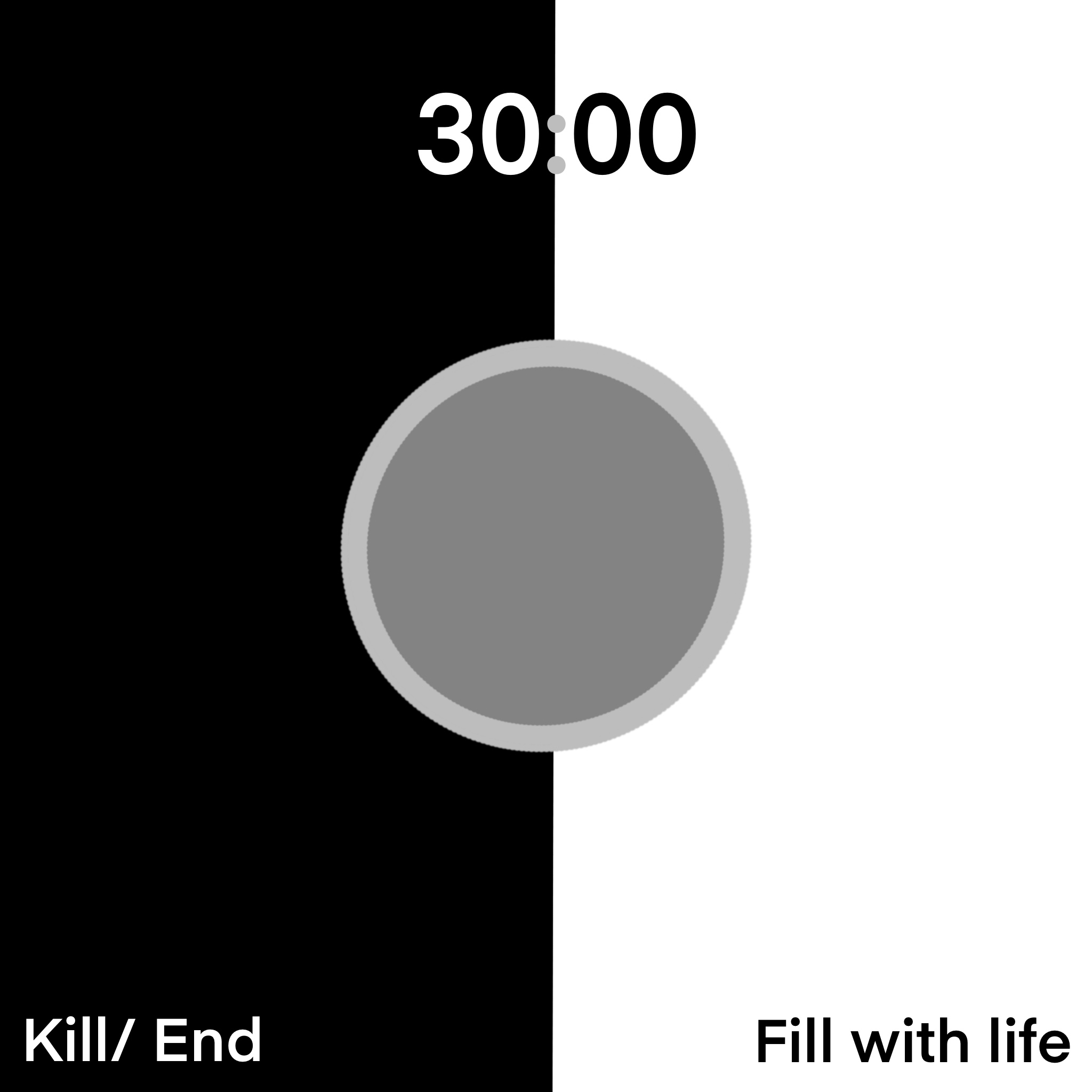
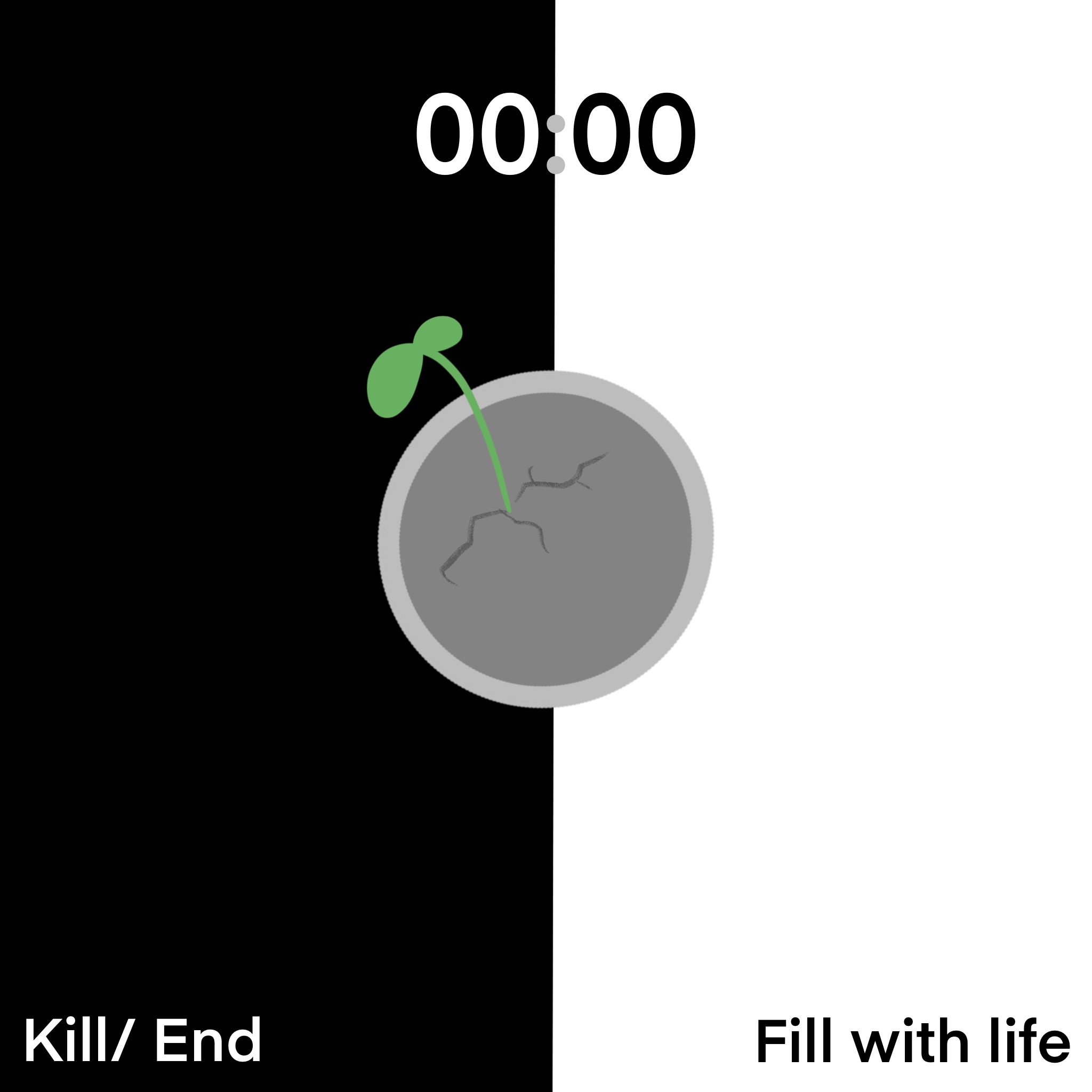
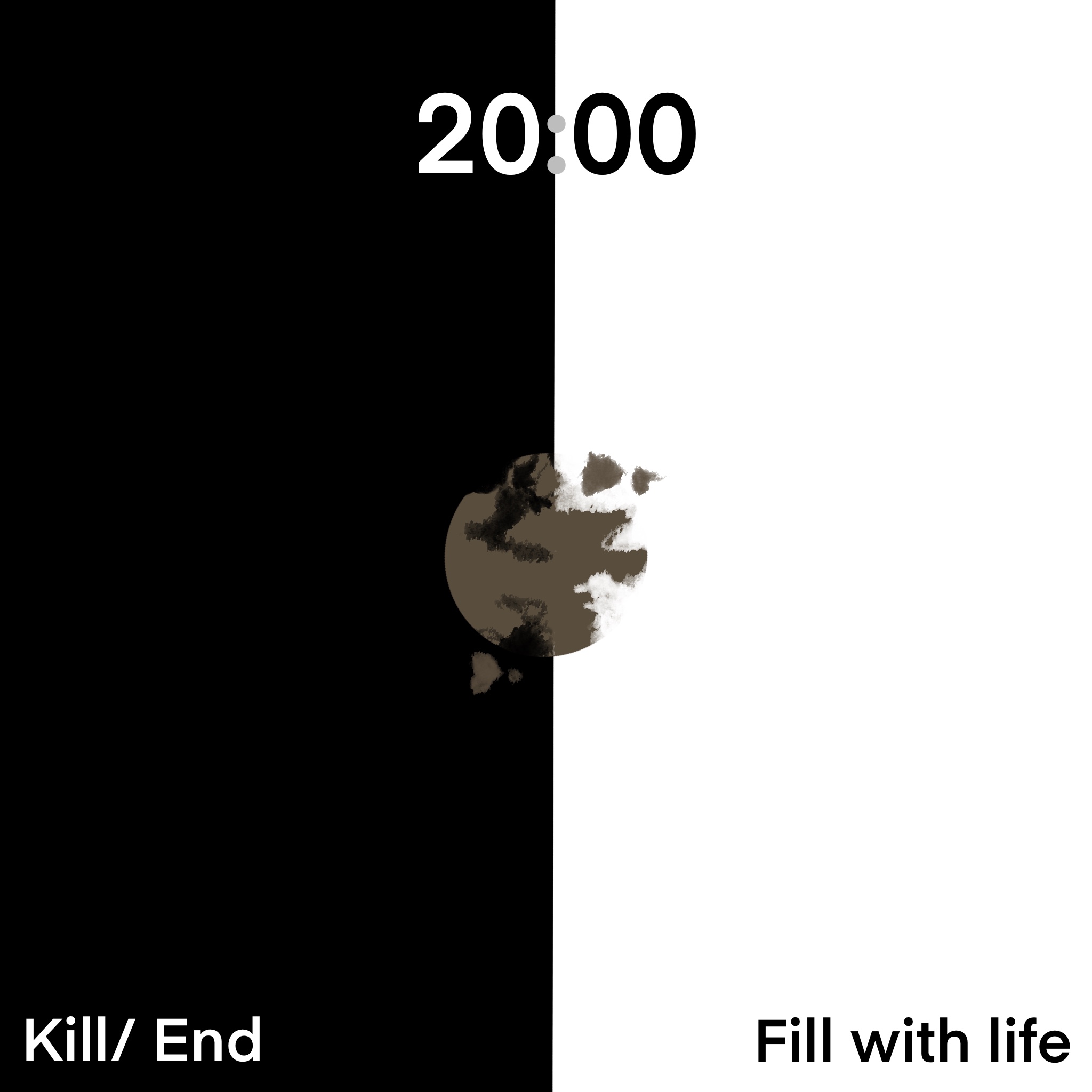
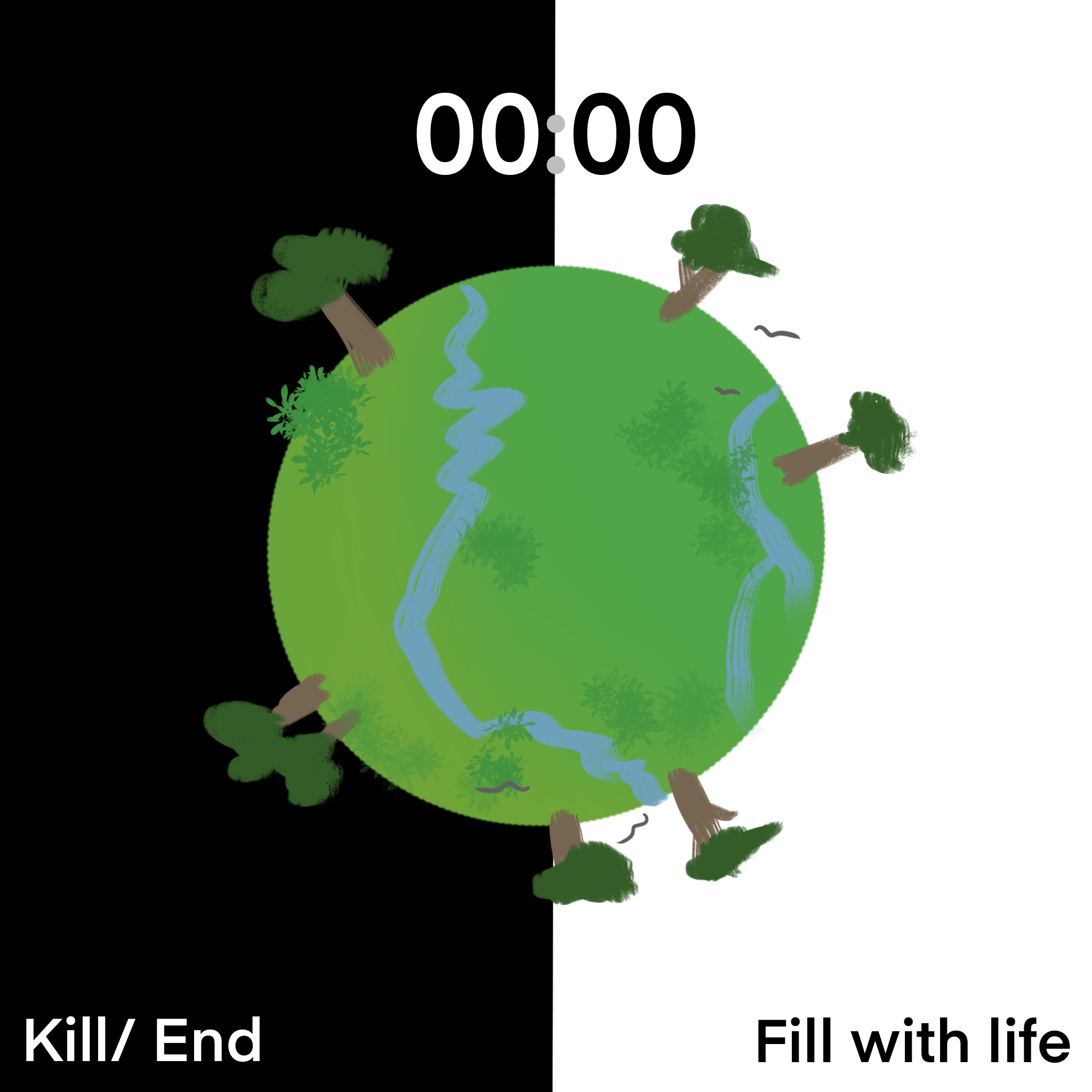





















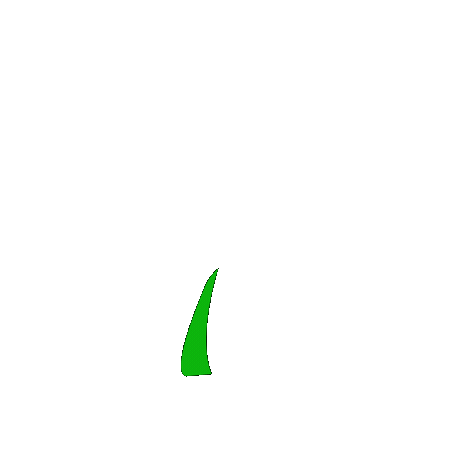
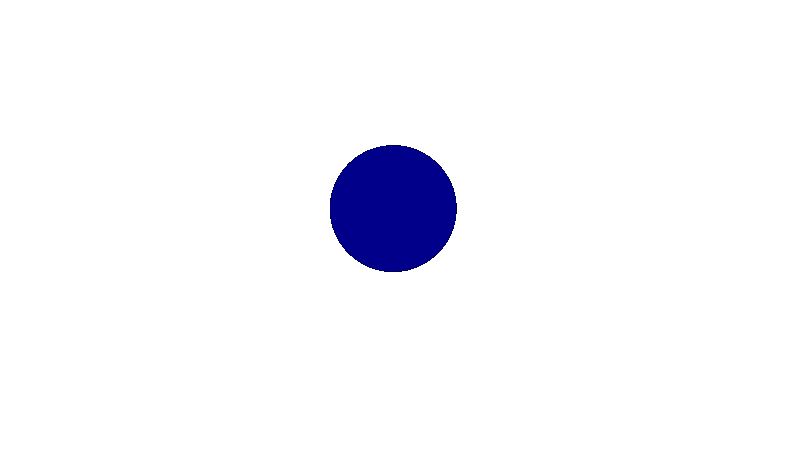
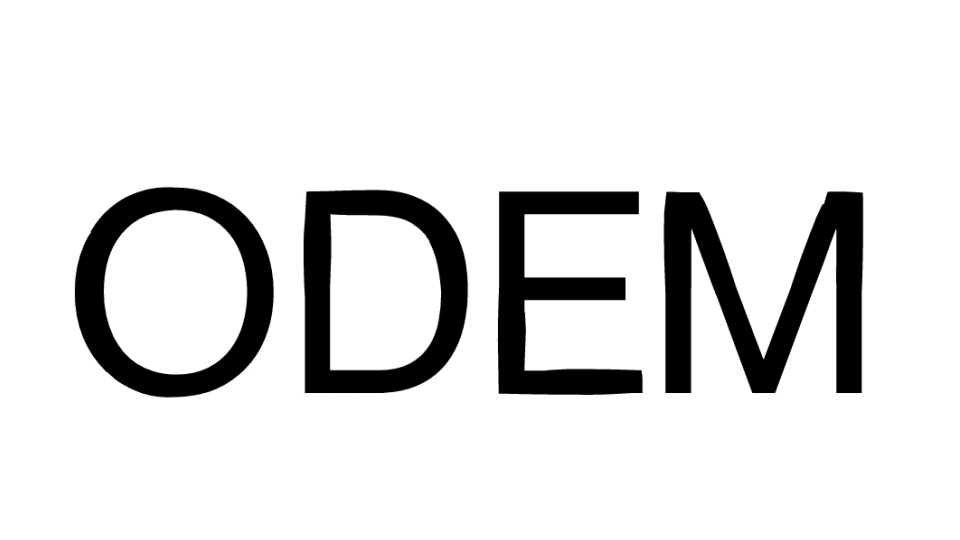
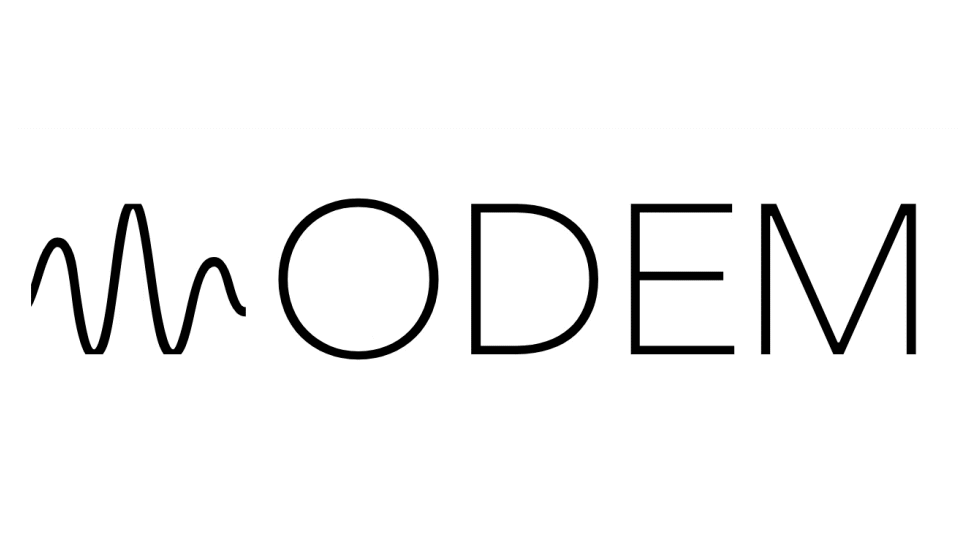
Wie bereits erwähnt ist die visuelle Gestaltung der
Interaktionsoberflächen/Interfaces,
der
Animationen sowie der generellen Formensprache abstrahiert, um den Nutzer kein
eindeutiges Bild zu
suggerieren oder einen inhaltlichen Standpunkt vorzugeben. Der Nutzer soll sich
seine
eigene Meinung
zum Prozess und Geschehen machen. Raum für Interpretationen ist gewünscht.
Die Webseite wurde mithilfe von HTML, CSS, Javascript erstellt. Dazu wurde die
JS-Bibliothek P5js für die Animation der Applikation verwendet.
Zur Programmierung und Animation wurden Visual Studio Code & WebStorm
IDE, Github, Adobe After Effects, Adobe XD, Adobe Illustrator und Procreate
verwendet.
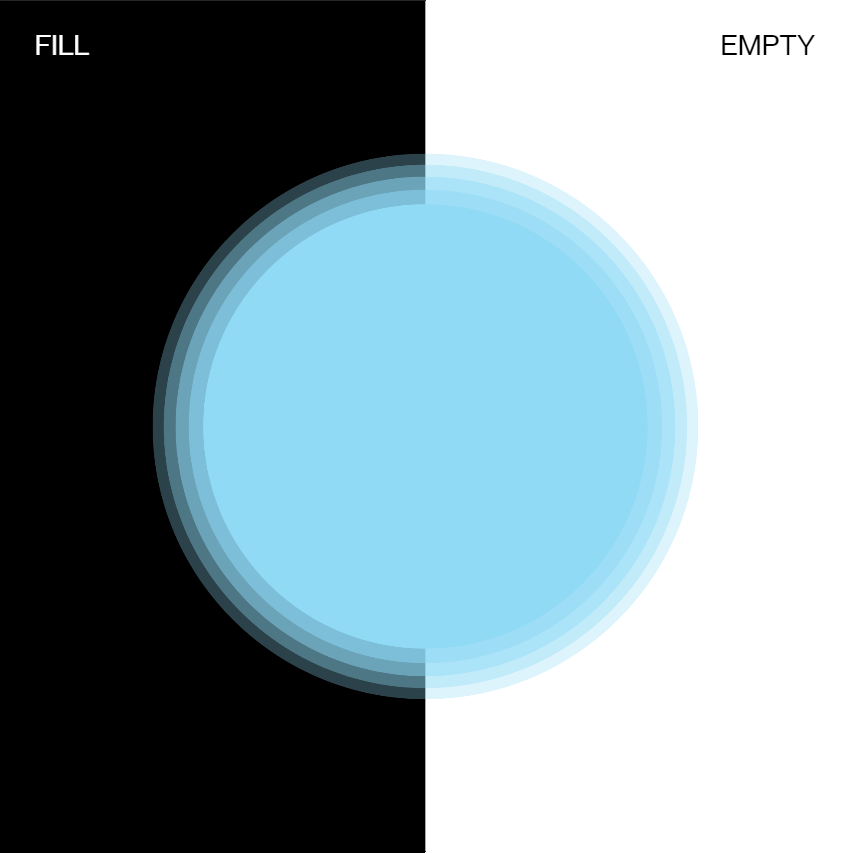
Start
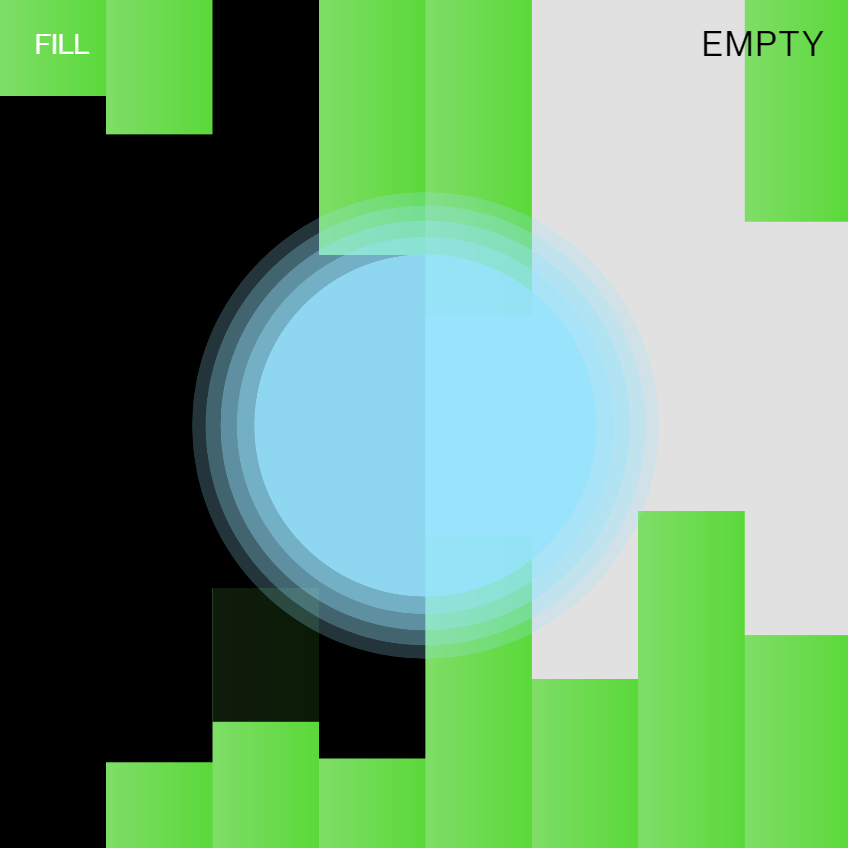
Atmung konstant

Explodiert fast
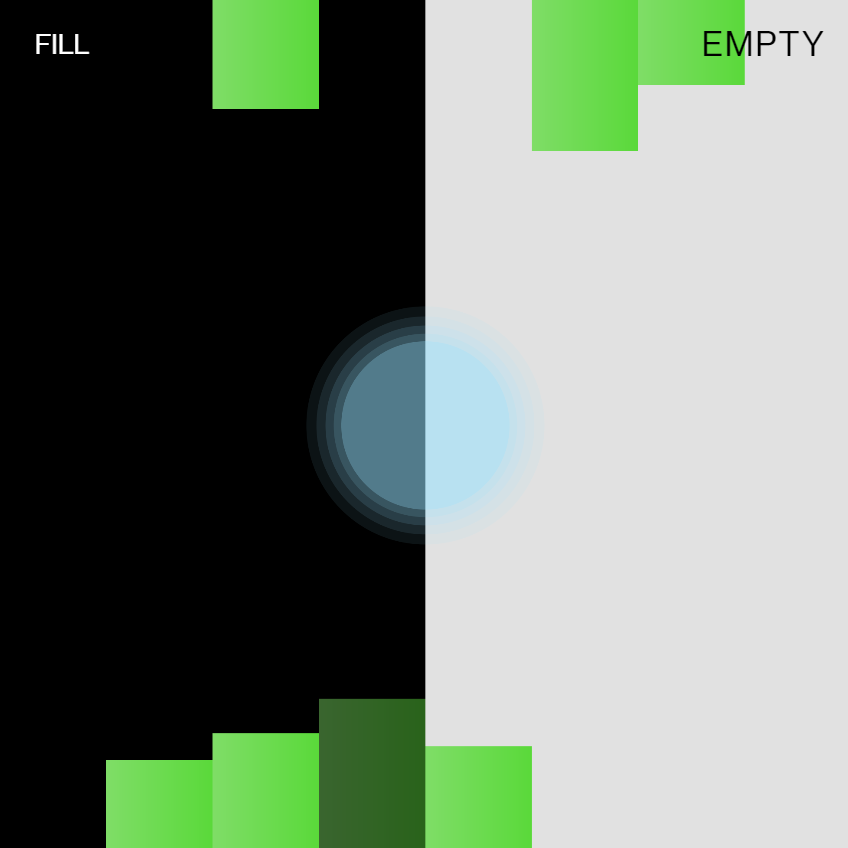
Implodiert fast
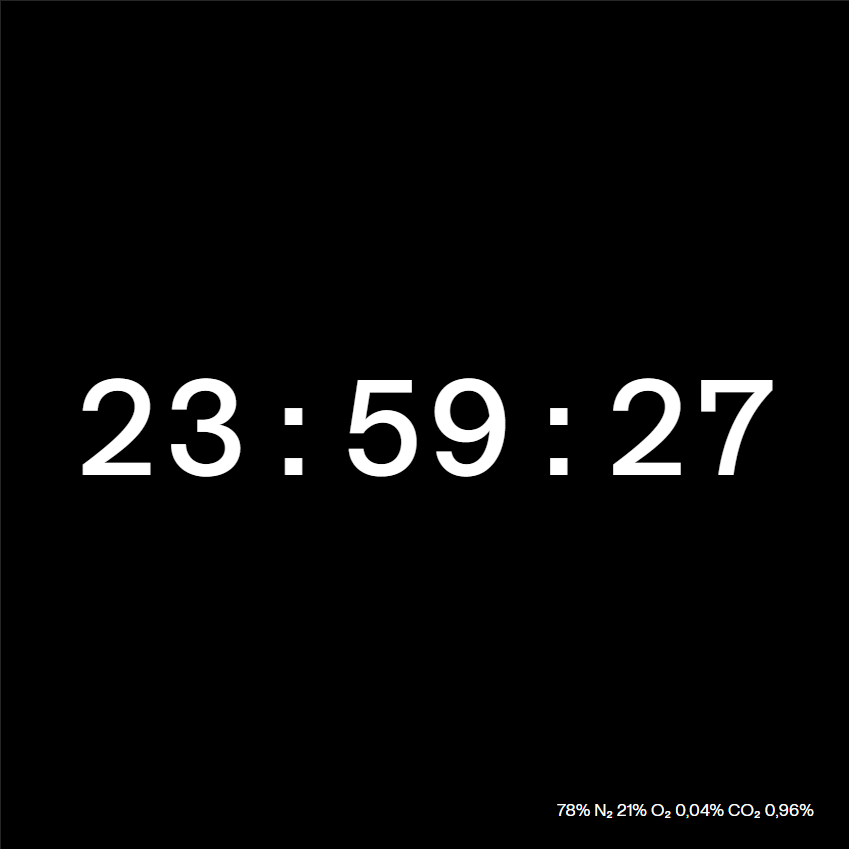
Nach der Explosion
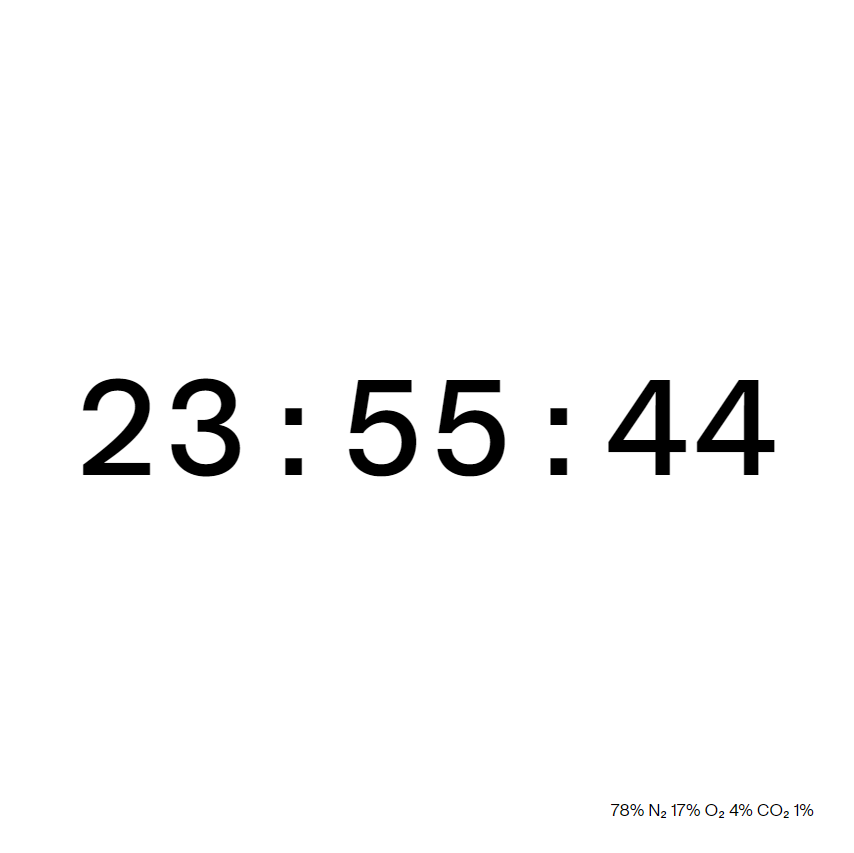
Nach der Implosion
AUSBLICK
Das Experiment ist für eine Vielzahl an Nutzern im digitalen Raum zugänglich und erfahrbar. Nun liegt es nahe, das entwickelte Konzept nochmals auf analoge Durchführbarkeit zu testen. An dieser Stelle ist es durchaus vorstellbar, der Grundgedanke der interaktiven Installation erneut in Betracht zu ziehen. Die visuelle, abstrakte Sprache des derzeitigen Experiments kann übernommen werden und dementsprechend analog übertragen werden. Der Vorteil einer im realen Raum konstruierten Installation ist die persönlichere Erfahrungsebene der Rezipient*innen. Die Rezipient*innen bewegen nicht nur den Mauszeiger von links nach rechts, sondern können physisch mit dem Versuchsaufbau interagieren. Zum anderen bestünde die Möglichkeit, das Experiment wahrhaftig irreversibel zu gestalten, um der Botschaft mehr Nachdruck zu verleihen. Demgegenüber ließe sich auch der digitale Aspekt durch erweiterte technische Mittel und Medien ausweiten. Mithilfe von AR oder VR kann der imitierte Atmungsprozess im Real/Digital-Zwischenraum visualisiert und wahrnehmbar gemacht werden.